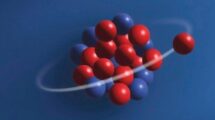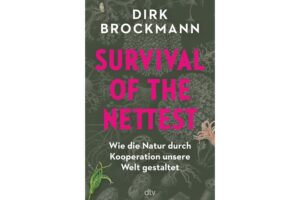Wenn extrasolare Gasriesen ihrem Stern zu nahe kommen, kann dieser Teile ihrer Atmosphäre ins All hinausreißen. Manchmal wird dies als langer Gasschweif sichtbar, den der betroffene Planet hinter sich herzieht. Jetzt haben Astronomen erstmals entdeckt, dass ein Exoplanet gleich zwei solcher Schweife ausgebildet hat. Der heiße Gasriese WASP-121b besitzt massereiche Heliumschweife, die die Hälfte seiner Umlaufbahn um den Stern ausfüllen. Das zeigen Beobachtungen des heißen Gasriesen WASP-121b mit dem Nahinfrarot-Spektrographen NIRISS am James-Webb-Weltraumteleskop. Dieser doppelte Schweif wirft ein neues Licht auf die Mechanismen, durch die Planeten ihre Atmosphäre verlieren können. Noch ist allerdings unklar, ob WASP-121b im Hinblick auf diesen Doppelschweif ein Einzelfall ist oder nicht.
Viele der bisher bekannten Exoplaneten sind sogenannte heiße Jupiter: Gasriesen, die ihren Stern auf einer sehr engen Umlaufbahn umkreisen. Meist benötigen sie nur wenige Tage für einen Umlauf und kehren ihrem Stern immer die gleiche Seite zu. Entsprechend stark aufgeheizt sind diese Planeten. Auf der Tagseite ist es oft heiß genug, um Gasmoleküle zu zerreißen und Metalle verdampfen zu lassen. Auf der Nachtseite kann es flüssiges Metall regnen. Doch die Nähe zum Stern hat noch eine weitere Folge: Die intensive, energiereiche Strahlung bläht die Atmosphäre dieser Gasriesen auf und reißt leichte Gase ins All hinaus. Über Millionen von Jahren kann dies die Größe, Zusammensetzung und zukünftige Entwicklung eines Planeten verändern. In besonders drastischen Fällen wird dieser Gasverlust sogar sichtbar: Die betroffenen Planeten ziehen lange Gasfahnen hinter sich her, ähnlich dem Schweif eines Kometen. Solche planetaren Schweife zeigen sich unter anderen durch subtile Abschattungen beim Planetentransit – dem Vorüberwandern des Planeten vor seinem Stern.
Ein heißer Jupiter mit Gasverlust
Doch bisher konnte Astronomen immer nur Momentaufnahmen solcher planetaren Gasschweife beobachten. Die Transitbeobachtungen erlauben zudem nur den Nachweis eines Schweifs im nahen Umfeld des Planeten. Wie weit diese Gasströme aber hinausreichen und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln, blieb unklar. Deshalb hat ein Team um Romain Allart von der Universität von Montreal jetzt den NIRISS-Spektrographen des James-Webb-Teleskops genutzt, um einen heißen Jupiter näher zu untersuchen. Ziel ihrer Beobachtungen war der rund 850 Lichtjahre entfernte Exoplanet WASP-121b. Dieser Gasriese ist rund 1,2 Jupitermassen schwer und ist auf rund 1,8 Jupiterradien aufgebläht. Aus früheren Beobachtungen ist bekannt, dass der Planet nur rund 1,27 Tage für einen Umlauf um seinen Stern benötigt und dass seine Tagseite auf mehr als 2700 Grad aufgeheizt ist. Transitbeobachtungen legten zudem nahe, dass der Gasriese Helium ans Weltall verliert. „Aber man konnte nicht präziser eingrenzen, welches Ausmaß dieser Helium-Ausstrom hat“, erklären die Astronomen.
Deshalb haben Allart und sein Team nun WASP-121b über eine Zeitspanne von gut 37 Stunden mit dem NIRISS-Spektrographen ins Visier genommen – und damit mehr als einen kompletten Umlauf des Planeten um den Stern. Die dabei gewonnenen Spektraldaten verraten unter anderem, ob und wo Helium aus der Gashülle des Planeten entweicht, aber auch, wie umfangreich und ausgedehnt der Gasausstrom aus seiner Atmosphäre ist. Sie stellen die vollständigste kontinuierliche Beobachtung der Heliumsignatur eines Planeten dar, die je aufgezeichnet wurde. Die Absorption der Heliumatome im infraroten Wellenlängenbereich bestätigte, dass der heiße Jupiter WASP-121b tatsächlich große Mengen Helium verliert. Die spektrale Helium-Signatur war in fast 60 Prozent der Bahn des Planeten um seinen Stern nachweisbar, wie die Astronomen berichten. Dies sei der längste bisher ermittelte kontinuierliche Nachweis von atmosphärischem Gasverlust. „Wir waren unglaublich überrascht, wie lange der Heliumausfluss anhielt“, sagt Allart.
Zwei Schweife statt einem
In näheren Analysen zeigte sich, dass der heiße Gasriese WASP-121b nicht nur einen langen Heliumschweif hinter sich herzieht, wie erwartet. Stattdessen wiesen die Astronomen zwei verschiedene Schweife nach: Einer liegt auf der vom Stern abgewandten Seite des Planeten, der durch Strahlung und Sternenwind vom Stern weggetrieben wird. Der zweite, dichtere Schweif eilt dem Planeten voraus und zeigt in Richtung des Sterns. Er wird offenbar von dessen Schwerkraft angezogen, wie Allart und seine Kollegen erklären. Zusammen erstrecken sich die beiden Helium-Ausströmungen über das 107-Fache des Planeten-Durchmessers. „Diese Entdeckung offenbart die komplexen physikalischen Prozesse, durch die Exoplaneten-Atmosphären mit ihrer stellaren Umgebung interagieren. Wir beginnen gerade erst, die wahre Komplexität dieser Welten zu erfassen“, sagt Allart. Gleichzeitig deckt diese Entdeckung Lücken in den bestehenden Modellen zum Gasverlust aus Planetenatmosphären auf. Denn solche Modelle können zwar einzelne, kometenähnliche Schweife erklären und nachbilden, nicht aber die neu beobachtete Doppelstruktur, wie die Astronoemen erklären.
„Wir müssen nun überdenken, wie wir den atmosphärischen Massenverlust simulieren – nicht mehr als einfachen Strom, sondern als eine 3D-Geometrie, die mit ihrem Stern interagiert. Das ist entscheidend, um zu verstehen, wie sich Planeten entwickeln“, sagt Allart. Denn der Verlust der Atmosphäre ist einer der Schlüsselfaktoren, die bestimmen, ob ein Planet ein Gasriese bleibt, zu einem neptunähnlichen Planeten schrumpft oder bis auf einen felsigen Kern abgetragen wird. Nach Ansicht der Forschenden könnte der nun entdeckte doppelte Gasverlust vielleicht sogar erklären, wie die seltenen „heißen Neptune“ entstanden sind – nah um ihren Stern kreisende Gasplaneten. Möglicherweise sind sie die Überreste von einst weit größeren heißen Jupitern, die den größten Teil ihrer Gashülle verloren haben. Noch ist allerdings unklar, ob der Doppelschweif von WASP-121b typisch für solche sternennahen Gasriesen ist oder ob der Exoplanet in dieser Hinsicht ein Einzelfall ist. Die Astronomen hoffen, dies durch weitere Beobachtungen ähnlicher Systeme klären zu können.
Quelle: Romain Allart (Université de Montréal) et al., Nature Communications, doi: 10.1038/s41467-025-66628-5